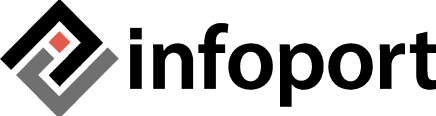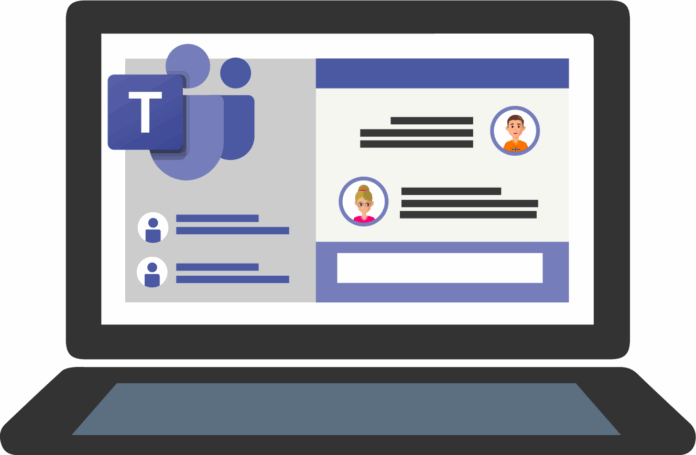Warum nachhaltige Wissenssicherung messbar sein muss
Stellen Sie sich einmal vor: Was wäre,…
…wenn CEOs den Wert von Wissenscommunities anhand konkreter Kennzahlen erkennen könnten.
… wenn Wissensgebende und Wissensnehmende die Wirkung ihrer Zusammenarbeit besser nachvollziehen könnten.
… wenn Wissen und Erfahrung als messbare Währung im Unternehmen verstanden und in Zahlen ausgedrückt würden.
Dann würden die Grenzen zwischen formellen Hierarchien und informellen Netzwerken zunehmend verschwimmen. Vermeintlich „weiche“ Themen wie Lernen und Wissensaustausch fänden endlich ihren Platz am unternehmerischen Strategietisch – und ein neuer Pool an Kennzahlen und Messgrößen entstünde.
Dieser Artikel ist der fünfte Teil unserer Artikel-Serie rund um das Thema „Wissens-Community-Management – die Kunst, eine nachhaltig wirksame Wissenstransferlandschaft aufzubauen und zu managen.“
Diesmal geht es um Zahlen, Daten, Fakten und Erfolgsindikatoren – und darum, wie Sie Ihre Wissenssicherung messbar machen.
Wenn CEOs den Wert erkennen sollen, muss das Thema für sie relevant sein
Starten wir mit zwei Beispielen:
1. Die L&D-Perspektive:
Peter leitet seit drei Jahren die Personalentwicklung eines mittelständischen Dienstleistungsunternehmens. Gemeinsam mit seinem vierköpfigen Team verantwortet er die Weiterbildungsbedarfe der gesamten Belegschaft – vor allem im formellen Bereich.
Durch seine Vernetzung mit anderen L&D-Experten weiß er um die Kraft des informellen Lernens und möchte die Idee von Wissenscommunities im Unternehmen vorantreiben.
Im Pitch beim Vorstand berichtet er von Formaten wie Working Out Loud und LernOS sowie von Rollenmodellen im Community-Aufbau. Er zeigt, wie moderne Tools Wissen strukturiert erfassen und dokumentieren und wie KI-basierte Anwendungen die Inhalte im Handumdrehen in alle relevanten Sprachen übersetzen – ein echter Gewinn für die Wissenssicherung im gesamten Unternehmen.
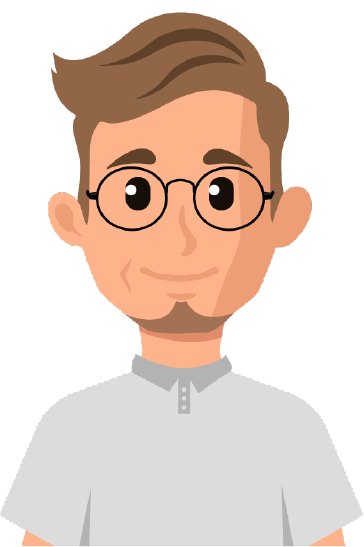
2. Die Fachbereichs-Perspektive:
Clarissa leitet eines der Vertriebsteams und ist verantwortlich für Neukundenakquise und die Ausschöpfung bestehender Potenziale. Die Vertriebsziele sind ambitioniert, aber machbar.
Im letzten Teamleiterzirkel zeigt sich jedoch: Die Zahl der neu gewonnenen Kunden liegt zwar im Zielbereich, die durchschnittliche Marge der Erstaufträge ist in den letzten Monaten jedoch deutlich gesunken.
Das Führungsteam ist sich einig: In die Verhandlungskompetenz muss investiert werden – durch gezielte Schulungen und den Aufbau eines „Think Tank Negotiation”.
Im Pitch beim Vorstand rechnet Clarissa vor, welchen finanziellen Effekt bereits eine Margenerhöhung von nur einem Prozent auf das Gesamtjahresbudget hätte. Sie berichtet von erfolgreichen Verhandlungen erfahrener Kollegen, von ihren Strategien in schwierigen Situationen – und davon, wie andere Teams von diesem Wissen profitieren können.
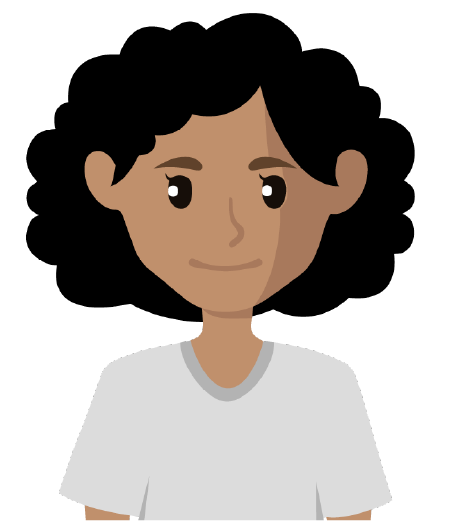
Was denken Sie?
Wer bekommt das GO vom Vorstand für den Aufbau einer Wissenscommunity – Peter oder Clarissa?
Der Wert von Wissen und Erfahrung zeigt sich im Ergebnis
CEOs steuern ihre Unternehmen anhand klar definierter Kennzahlen – meist branchenspezifisch, manchmal auch individuell an die Organisation angepasst.
Notieren Sie sich diese Kennzahlen einmal und überlegen Sie, welchen Anteil Wissen und Erfahrung an deren Entwicklung haben.
Im Vertrieb lässt sich das oft leicht beantworten, denn dort ist man es gewohnt, Daten zu erfassen und an messbaren, meist monetären Ergebnissen zu arbeiten.
Doch wie sieht es in anderen Branchen aus – etwa in der Pharmaproduktion?
Hier achtet das Management beispielsweise auf die Anzahl von Abweichungen im Produktionsprozess (zurückzuführen auf menschliches Verhalten) pro Batch oder Monat. Oder auf den Anteil der Produkte, die den Prozess ohne Nacharbeit oder Ausschuss durchlaufen (First Pass Yield (FPY)). Messbare Größen, die zeigen, welchen Einfluss Wissen und Erfahrung auf das Ergebnis haben.
Und wie ist es in ganz anderen Bereichen – sagen wir, in Kindergärten öffentlicher Träger?
Hier spielen wirtschaftliche Kennzahlen vielleicht nicht die größte Rolle. Dennoch erfasst die Leitung, wie viele Kinder die Schulreife erlangen – also mit den nötigen Fähigkeiten in die Grundschule wechseln –, welche Rückmeldungen von dort kommen und mit wie vielen Betreuungspersonen diese Ergebnisse erreicht werden.
Auch das sind messbare Größen.
„Wer Wissenscommunities erfolgreich implementieren möchte, sollte wie die Unternehmensführung denken.“
Diese Aussage findet sich auch in den Talent Development Reporting Principles (TDRp) – einem Rahmenwerk zur standardisierten Messung und Berichterstattung von Personalentwicklungs- und Weiterbildungsaktivitäten. Entwickelt wurde es von der Initiative Center for Talent Reporting (CTR), um HR- und L&D-Bereichen eine vergleichbare und strategisch relevante Erfolgsmessung zu ermöglichen.
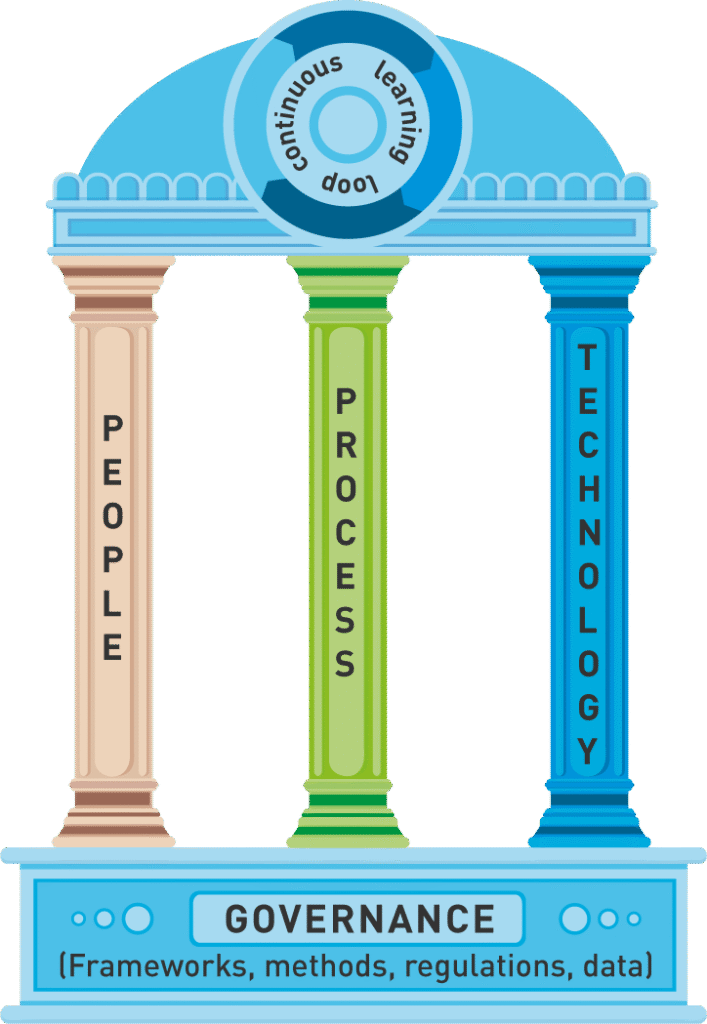
Wie geht es nach der Initialisierung weiter?
Schauen wir uns das am Beispiel von Clarissas „Think Tank Negotiation“ an.
Die von ihr erfassten Daten könnten unter anderem folgende Punkte umfassen:
- Anzahl der Mitglieder insgesamt
- Anzahl der Coachingsessions zur Vorbereitung auf anstehende Verhandlungen
- Anzahl interner Treffen und die jeweilige Teilnahmequote
- Zufriedenheit der Mitglieder
- Dokumentation der Verhandlungsergebnisse
- je Verhandlungssituation
- im Verlauf der Zeit
- je Mitglied
Durch die systematische Erfassung dieser Kennzahlen lässt sich ein Vergleich zu bisherigen Verhandlungsergebnissen ziehen – etwa in Bezug auf Umsatz, Marge oder die Anzahl neuer Rahmenverträge.
So wird der Wert der Wissenscommunity messbar und nachvollziehbar.
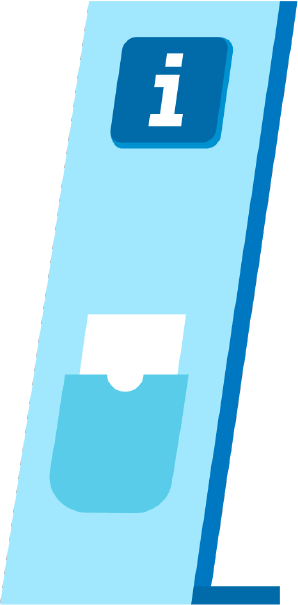
Artikel Empfehlung:
Wenn Sie sich noch in der Planungsphase Ihrer Wissenscommunity befinden, finden Sie in unserem Artikel „Wissenscommunity nachhaltig aufbauen – So gehen Sie vor!“ wertvolle Hinweise zur strategischen Vorbereitung.
Was verliert ein Unternehmen eigentlich, wenn ein Fachexperte geht?
Eine zentrale Rolle in jeder Wissenscommunity spielen die Fachkräfte, die ihr Wissen und ihre Erfahrung teilen.
Doch was passiert, wenn eine dieser Schlüsselfiguren das Unternehmen verlässt?
Eine Möglichkeit, den Verlust messbar zu machen, ist die Übersetzung des Gehaltes in Wertschöpfung.
Die Ausgangsprämisse
Gehen wir davon aus, dass ein Unternehmen nur dann einen Mitarbeitenden fest einstellt, wenn diese Person mindestens in Höhe ihres eigenen Jahresgehalts Wertschöpfung erwirtschaftet.
In bestimmten Positionen – etwa im Vertrieb oder im Management – liegt die Erwartung oft deutlich höher. Hier kann mit Multiplikationsfaktoren gearbeitet werden, um den tatsächlichen Beitrag zur Unternehmensleistung abzubilden.
Ein Rechenbeispiel aus Clarissas Team
Ein Vertriebskollege erhält ein Jahreszielgehalt von 75.000 € brutto.
Addiert man rund 30 % Sozialabgaben für das Unternehmen, ergibt sich eine Gesamtkostenbasis von 97.500 €.
Teilen wir diesen Wert durch die jährlichen Arbeitstage (252 Tage minus 30 Urlaubstage und 5 Krankheitstage = 217 effektive Arbeitstage), ergibt sich:
97.500 € ÷ 217 Tage = 449,31 € pro Tag bei 100 % Performance.
Da es sich um einen Außendienstmitarbeitenden mit einem ambitionierten Vertriebsziel handelt, rechnen wir mit einem Leistungsfaktor von 2,5.
Somit ergibt sich eine erwartete Wertschöpfung von 1.123,27 € pro Tag.
Verlässt dieser Mitarbeitende das Unternehmen, entstehen mehrere Verlustarten:
- Wertschöpfungsverlust während der Vakanz:
Durchschnittliche Vakanzzeit bis zur Wiederbesetzung der Position laut Bundesagentur für Arbeit (Sept 2024 – Okt 2025): 169 Tage
→ 1.123,27 € × 169 Tage = 189.832,95 € - Direkte Rekrutierungskosten:
Etwa 30 % des Jahreszielgehalts → 22.500 € - Einarbeitungs- und Onboarding-Kosten:
Interne und externe Trainings, Reisekosten, Produktivitätsausfall → 10.000 € - Reduzierte Performance in der Einarbeitungsphase:
Ausgehend von einer durchschnittlich reduzierten Wertschöpfung auf 80% in den ersten 16 Monaten → 64.925,12 €
Gesamtkosten durch den Weggang eines Experten:
189.832,95 € (Wertschöpfungsverlust)
+ 22.500 € (Rekrutierungskosten)
+ 10.000 € (Onboarding)
+ 64.925,12 € (reduzierte Performance)
= 287.258,07 € Gesamtkosten
Und selbst dieser Betrag berücksichtigt noch nicht den immateriellen Schaden: den Verlust von Beziehungen, Erfahrungswissen und Netzwerken, die oft über Jahre gewachsen sind.
Was kostet der Verlust von Netzwerken und Beziehungen?
Diese Kosten sind erheblich schwieriger zu beziffern – zumindest in konkreten Zahlen. Hier hilft die Definition eines Netzwerk-Index, der sich aus der Beantwortung gezielter Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammensetzt:
Externe Perspektive – Kunden und Geschäftspartner
- Wie wichtig ist Ihnen der persönliche Kontakt zu Ihrer Ansprechperson im Vertrieb?
- Inwiefern beeinflusst die Beziehung zu dieser Person Ihre Kaufentscheidung?
- Wie sehr haben Sie den Eindruck, dass Ihre Ansprechperson Ihre Interessen versteht und berücksichtigt?
- Inwieweit wenden Sie sich an Ihre Ansprechperson, wenn Sie sich über ein Produkt oder Angebot unsicher sind?
- Wie zuverlässig ist Ihre Ansprechperson bei zugesagten Leistungen oder Reaktionszeiten?
- Wie authentisch wirkt Ihre Ansprechperson auf Sie?
- Inwiefern hilft Ihnen Ihre Ansprechperson, bessere Entscheidungen zu treffen?
- Wie sehr trägt die Beziehung zur Effizienz oder zum Erfolg der Zusammenarbeit bei?
- Inwieweit profitieren Sie durch die Beziehung über das Produkt oder den Preis hinaus (z. B. Zeitersparnis, Priorisierung, Sonderlösungen)?
- Wie stark hängt Ihre Zusammenarbeit mit unserem Unternehmen vom persönlichen Kontakt zu Ihrer derzeitigen Ansprechperson ab?
Interne Perspektive – Kollegen
- Welche Rolle spielen persönliche Beziehungen für die Zusammenarbeit in Ihrem Bereich?
- Wie stark unterstützt Sie Ihr persönliches Netzwerk im Arbeitsalltag?
- Wer sind die Personen, die Dinge „ins Rollen bringen“, weil sie gut vernetzt sind?
- Können Sie Beispiele nennen, in denen eine gute Beziehung im Unternehmen ein Projekt oder eine Entscheidung erleichtert hat?
- An wen wenden Sie sich bei fachlichen Fragen und warum?
- Welche Personen bauen besonders effektiv Brücken zwischen Teams oder Hierarchieebenen?
- Wem vertrauen Sie besonders, wenn Sie Rat oder Feedback brauchen?
- Wie hat Ihnen Ihr internes Netzwerk konkret geholfen (z. B. bei Problemlösungen, Innovationen oder Karriereentwicklung)?
- Was würde fehlen, wenn bestimmte Personen oder Verbindungen wegfallen würden?
- Inwiefern erleichtert Ihr Netzwerk den Zugang zu Ressourcen oder Entscheidungen?
Führungsperspektive
- Welche Bedeutung haben interne Netzwerke für die Leistung und Entwicklung Ihrer Mitarbeitenden?
- Inwiefern berücksichtigen Sie Netzwerkfähigkeit bei der Auswahl oder Förderung von Mitarbeitenden?
- Wie stark hängt der Erfolg Ihres Bereichs von funktionierenden internen Beziehungen ab?
- Welche Mitarbeitenden schaffen es, über Abteilungsgrenzen hinweg Einfluss zu nehmen?
- Woran erkennen Sie, dass [Name der Person] über ein starkes internes Netzwerk verfügt?
- Welche Projekte oder Erfolge wären ohne diese Netzwerke schwieriger oder gar nicht möglich gewesen?
- Wie gehen Sie mit Mitarbeitenden um, die stark vernetzt sind, aber außerhalb formaler Hierarchien wirken?
- Welche messbaren oder beobachtbaren Vorteile ergeben sich durch gut vernetzte Mitarbeitende?
- Wie reagieren Sie, wenn stark vernetzte Personen das Unternehmen verlassen und wie groß ist die Lücke, die entsteht?
- Welche Bedeutung haben Wissenscommunities für Ihr Unternehmen?
Artikel Empfehlung:
Für den nachhaltigen Erfolg Ihrer Wissenssicherung spielt die klare Rollenverteilung in der Community eine zentrale Rolle. Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel: „Rollen einer Wissenscommunity – Welche wichtig sind und wie sie besetzt werden”
Von qualitativen Antworten zu messbaren Werten
Die Antworten lassen sich anschließend – wo sinnvoll – in nominelle Werte überführen, beispielsweise über eine Likert-Skala.
Bei Bedarf können Gewichtungen hinzugefügt werden, wenn bestimmte Aspekte eine besonders hohe Relevanz für den Unternehmenserfolg besitzen.
Je Kategorie wird dann ein Mittelwert gebildet.
Je höher der Netzwerk- und Beziehungsindex, desto größer der Wertbeitrag für das Unternehmen – und desto höher der Verlust, wenn eine gut vernetzte Person das Unternehmen verlässt.
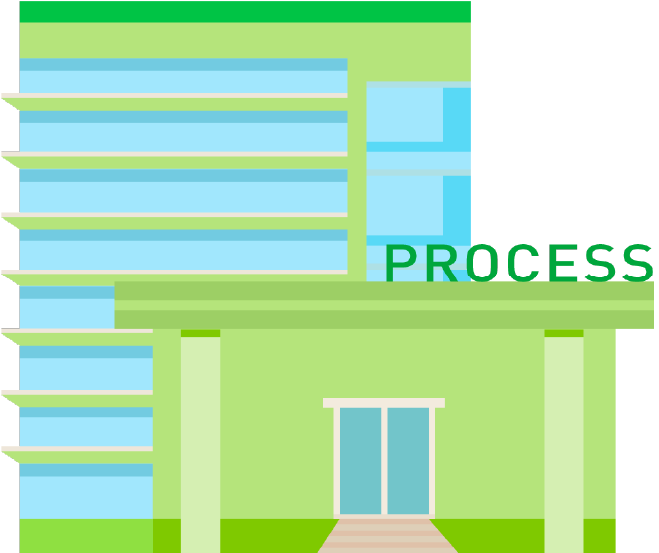
Die Zukunft der Wissenssicherung: Wenn Wissen als Währung gehandelt wird …
Stellen wir uns vor, Wissen und Erfahrung gelten im Unternehmen als handelbare Ressource.
Jede Person hat ein „Wissenskonto“, das sich durch den Erwerb, die Weitergabe und die Anwendung von Wissen verändert.
Zudem besitzt jeder ein Wissensportfolio, bestehend aus Fachwissen, Erfahrung, Problemlösungskompetenz und Innovationsfähigkeit.
Wer neues Wissen erwirbt, zum Beispiel durch Fortbildungen, Forschung oder Projektarbeit, „verdient“ Wissenseinheiten.
Dieses Portfolio lässt sich in einer Software abbilden, die personalisierte Skill-Profile erfasst – zum Beispiel in Systemen wie Degreed, Cornerstone oder SAP SuccessFactors.
Wer nun Wissen teilt, dokumentiert oder vermittelt, investiert es und erhält Rendite in Form von Reputation, Einfluss oder Projektpriorität.
Wissen, das veraltet oder ungenutzt bleibt, verliert dagegen an Wert – ähnlich wie eine Währung in der Inflation.
Wissenscommunities sind in diesem Modell die Tauschbörsen des Unternehmenswissens.
Jeder bringt Wissen ein und erhält im Gegenzug wertvolle Einblicke anderer.
Das individuelle Wissensportfolio wird zur Hauptbuchhaltung des persönlichen Wissens.
Lernen und Teilen entwickeln sich zu neuen Statussymbolen, und die Personalentwicklung verschmilzt stärker mit den Fachbereichen – wie in einer „Wissensbank“ oder „Akademie-Börse“.
Beispiel: Aufbau eines Wissensportfolios
Inhalte eines Wissensportfolios sind:
- Hard Skills: z. B. Data Science, Cyber Security, Verhandlungstechnik
- Soft Skills: z. B. Kritisches Denken, Empathie
- Kontextwissen: z. B. Markt-, Kunden- oder Prozesswissen
- Verbindungspunkte: Wer teilt Wissen mit wem? In welchen Themenclustern? Und wie häufig?
- Evidenzen: z. B. geteilte Dokumente, aufgezeichnete Beiträge, Projektfeedback
Diese Daten fließen automatisiert in Systeme wie Degreed, 360Learning oder Cornerstone ein – über APIs, Meeting-Integrationen und KI-gestützte Auswertungen.
KI als Wissens-Copilot
Während eines Meetings einer Wissenscommunity hört ein KI-gestützter Copilot mit (unter Einhaltung der Datenschutz- und KI-Richtlinien):
- Er transkribiert das Gespräch.
- Er erkennt durch semantische Analyse Wissenseinträge („Erklärung“, „Idee“, „Lösung“, „Erkenntnis“).
- Er verknüpft das Gesagte mit bestehenden Skill-Taxonomien (z. B. erkennt er, dass jemand Wissen zur Verhandlungstechnik beigetragen hat).
- Er erstellt automatisch einen Wissensbeitrags-Eintrag.
- Er platziert diesen im System-Feed der Person, wo er kommentiert, bestätigt oder bewertet werden kann – ähnlich einem Peer-Review.
Idealerweise verknüpft das System diese Einträge mit Projekt- und Feedbackdaten, um den tatsächlichen Impact des Wissensbeitrags messbar zu machen.
Wissenskapital als Unternehmenswert
Unternehmen könnten ihr Wissenskapital so künftig ähnlich wie immaterielle Vermögenswerte in ihren Jahresberichten ausweisen.
KI-Systeme würden dafür sogenannte Wissens-Reports generieren und sichtbar machen:
Wo geht Wissen verloren?
Wo entstehen neue Cluster?
Wie entwickeln sich die internen Wissensflüsse?
Strategische Entscheidungen basieren damit nicht mehr nur auf finanziellen, sondern auch auf kognitiven Kapitalflüssen.
Unternehmen mit hohem Wissenskapital könnten an einem Wissensmarkt partizipieren, auf dem ihr Wert steigt, je besser sie Wissen vernetzen und kluge Köpfe anziehen.
Das wiederum macht sie besonders attraktiv für neue Talente:
Denn wer erkennt, dass Wissen hier echten Wert besitzt, möchte gerne Teil davon werden.

Fazit
Wer beginnt, die richtigen Daten zu erfassen, kann die Relevanz von Wissenscommunities – und damit die Wirkung der Wissenssicherung – sichtbar machen.
Beginnen Sie dabei klein, aber strategisch:
- Nutzen Sie etablierte Standards wie Talent Development Reporting Principles (TDRp), Kirkpatrick Evaluation Model, Phillips ROI Methodology oder die ISO/TS 30437:2023-06.
- Erfassen Sie, wer Wissen teilt, wer es nutzt und welchen Einfluss das auf Projekte und Geschäftsergebnisse hat.
- Und bauen Sie Schritt für Schritt ein Data-Driven Knowledge Management auf, das sichtbar macht, was oft unsichtbar bleibt.
Sie möchten den Wert Ihrer Wissenssicherung greifbar machen?
Lassen Sie uns gemeinsam analysieren, wo Sie heute stehen und welche Daten Sie nutzen können, um Ihre Wissenscommunities messbar zu gestalten.
Hier geht’s zum kostenlosen Erstgespräch!
Offene Fragen?
Der Erfolg von Wissenscommunities lässt sich messen, indem Effektivität, Effizienz und der Beitrag zum Unternehmensergebnis bewertet werden.
Zu den wichtigsten Kennzahlen gehören dabei die Anzahl aktiver Mitglieder in Wissenscommunities, Beitragshäufigkeit, Wiederverwendungsrate von Wissen, Zeitersparnis durch geteiltes Wissen und der Einfluss auf Innovations- und Projektkennzahlen.
Künstliche Intelligenz kann große Datenmengen aus Wissensplattformen, Projekten oder Kommunikationskanälen analysieren und daraus Muster ableiten.
Sie erkennt, wo Wissen entsteht, geteilt oder verloren geht, und erstellt automatisch Wissens-Reports oder Impact-Analysen.
So unterstützt KI dabei, die Wissenssicherung und den Erfolg von Wissenscommunities objektiv messbar zu machen.
Der wirtschaftliche Nutzen von Wissenssicherung zeigt sich vor allem in reduzierten Einarbeitungszeiten, geringeren Rekrutierungskosten und höherer Prozessqualität.
Es sinkt der Aufwand für Problemlösungen und Entscheidungen, während Effizienz und Innovationskraft steigen.
Der erste Schritt besteht darin, gemeinsam mit dem Management zu klären, welche Unternehmenskennzahlen aktuell Priorität haben – und welchen Beitrag Wissenscommunities zur Zielerreichung leisten können.
Darauf aufbauend sollten passende Kennzahlen (KPIs) gewählt und regelmäßig erhoben werden, z. B. Beteiligung in Wissenscommunities oder Nutzung von Lerninhalten.
So entsteht Schritt für Schritt ein messbares und strategisch ausgerichtetes Wissensmanagement.
Sie haben noch eine offene Frage? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Autorin: Meike Leue – Beraterin für Kompetenz- und Wissensmanagement Profil bei LinkedIn