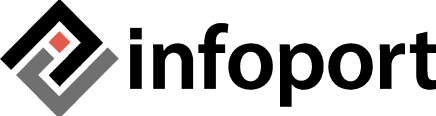Was möglich wird, wenn eine funktionierende Wissenscommunity Teil des Arbeitsalltags ist
Stellen Sie sich einmal vor: Was wäre,…
… wenn es ganz selbstverständlich zur Rolle jedes Wissensträgers in Ihrem Unternehmen gehörte, Wissen regelmäßig in passenden Formaten zu teilen – und dafür von Anfang an ausreichend Zeit zur Vorbereitung der Inhalte eingeplant wäre?
… wenn diese Wissensträger ihre Materialien nicht allein und ohne Unterstützung aufbereiten müssten, sondern wüssten: Mein Beitrag ist wertvoll – und wenn mir gerade die Zeit fehlt, um einen Blogartikel oder eine Präsentation auszuarbeiten, gibt es jemanden, der bei der Aufbereitung hilft und entlastet.
… wenn alle Live-Sessions – ob analog oder digital, ob Learn&Share oder Deep Dive – professionell nachbereitet würden und so in unterschiedlichen Formaten weiterverwendet werden könnten?
… wenn Mitarbeitende und Führungskräfte ganz selbstverständlich und regelmäßig auf die angebotenen Wissensformate (Videos, Artikel, Linkempfehlungen, Sessions) zugreifen würden – weil allen klar ist: Up-to-date zu bleiben ist wichtig, und jeder Wissensimpuls bringt echten Mehrwert für den Arbeitsalltag?
Ein Arbeitsalltag, in dem Wissen fließt, statt verloren zu gehen. In dem Lernen einfach dazugehört – und alle davon profitieren.
Dieser Artikel ist der zweite Teil unserer Artikel-Serie rund um das Thema „Wissens-Community-Management – die Kunst, eine nachhaltig wirksame Wissenstransferlandschaft aufzubauen und zu managen.“
Hier zeigen wir, worauf es beim Aufbau einer Wissenscommunity ankommt, welche Tools, Formate und Methoden sich in der Praxis bewährt haben – und wie eine Community entsteht, die langfristig lebt und wirkt.
Gute Vorbereitung ist der Schlüssel für nachhaltigen Erfolg
Worauf es in der Planungsphase ankommt
Damit eine Wissenscommunity nachhaltig funktioniert, braucht es von Anfang an eine klare Planung.
Der Aufbau und das Management sollten frühzeitig durchdacht, notwendige Ressourcen freigegeben und das Commitment zentraler Bildungs-Stakeholder eingeholt werden.
Allen Beteiligten – von Entscheidungsträgern bis zu Community-Verantwortlichen – sollte bewusst sein: Der Aufbau einer Wissenscommunity ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Communities, die stabil in den Arbeitsalltag integriert sind, entwickeln sich langsam – aber dafür nachhaltig.
Dabei hängt der langfristige Erfolg maßgeblich davon ab, dass sowohl Wissensträger als auch -empfänger erleben: Diese Community bringt echten Mehrwert für meine tägliche Arbeit.
Sind die ersten Mitglieder überzeugt, folgen weitere. Denn Erfolg und Nutzen sprechen sich herum.
Realistische Zeiträume einplanen
Es ist wichtig, einer Wissenscommunity von Beginn an einen realistischen Zeithorizont zu geben – idealerweise mindestens 18 Monate.
Warum so lange?
Die Praxis zeigt: Zwölf Monate reichen nicht aus, um eine Community tragfähig zu etablieren.
Allein zwischen Ende November und Mitte Januar ist das Engagement erfahrungsgemäß gering – Jahresabschluss, Feiertage und Neujahrsvorbereitungen binden die Aufmerksamkeit vieler Mitarbeitender. Für Community-Aktivitäten bleibt in dieser Zeit meist kaum Luft.
Eine ähnliche Ruhephase finden Sie in den Sommermonaten – etwa von Mitte Juli bis Mitte September –, wenn viele Kollegen im Urlaub sind.
Daher lässt sich erst nach rund eineinhalb Jahren wirklich beurteilen, ob sich die Community im Unternehmensalltag bewährt hat. Dann hat sie alle Jahreszeiten einmal durchlaufen – inklusive der typischen Hoch- und Tiefphasen.

Was zudem vor dem Start geregelt sein sollte:
- Integration in die vorhandene L&D Organisation & Infrastruktur: Eine Wissenscommunity soll kein isoliertes „Wissens-Dorf“ neben der bestehenden Lernlandschaft bilden. Vielmehr geht es darum, sie frühzeitig in die unternehmensweite Lerninfrastruktur und bestehende Prozesse einzubetten. Die enge Abstimmung mit zentralen Formaten, Plattformen und Angeboten ist dabei unerlässlich – denn isolierte Wissens-Dörfer haben langfristig keine Überlebenschance. Nur als Teil des großen Ganzen kann eine Community langfristig wirksam sein.
- Enge Zusammenarbeit mit L&D: Klare Rollen und Zuständigkeiten sind essentiell: Was gehört zur Verantwortung von L&D, was liegt im Fachbereich? Wer übernimmt das strategische, wer das operative Management der Community? Welche Formate und Tools sollen eingesetzt werden? Diese Fragen sollten frühzeitig geklärt und gemeinsam abgestimmt werden.
- Benennung eines Community Managers: Die Rolle eines Community Managers sollte von Anfang an klar definiert sein – inklusive Aufgabenprofil, zeitlicher Ressourcen, Verantwortungsbereich und einer konkreten Person, die diese Rolle übernimmt. Eine Community ohne klare Zuständigkeit für strategisches und operatives Management zu starten, ist selten erfolgreich. Denn die Realität zeigt: Die Aufgaben eines Community Managers werden oft unterschätzt. Was zunächst „nebenbei“ mitlaufen soll, bleibt nach wenigen Monaten liegen – und es zeigt sich, wie viel Arbeit ein professionelles Community Management tatsächlich bedeutet.
- Klarer thematischer Fokus und eindeutige Verantwortlichkeiten: Es muss definiert sein, welche Themen in der Wissenscommunity behandelt werden – und wer innerhalb der Organisation die Verantwortung dafür trägt: der Fachbereich, L&D oder beide gemeinsam? Diese Zuständigkeiten sollten im Vorfeld mit allen Stakeholdern abgestimmt werden. Fehlt eine klare Themenverantwortung, entstehen schnell parallele „Wissens-Dörfer“ zu identischen Inhalten – insbesondere bei Querschnittsthemen wie Projekt- oder Change Management. Sind die Zuständigkeiten hingegen eindeutig geregelt, kann Wissen gezielt gebündelt, sichtbar gemacht und an einer Stelle zugänglich gemacht werden. Das schafft echten Mehrwert – für Mitarbeitende wie auch für das Unternehmen – und sichert gleichzeitig die Auslastung und Relevanz der Community.
- Jeder kann Teil der Community sein – oder es werden: Sobald das thematische Profil der Wissenscommunity festgelegt ist, sollte auch geklärt werden, wer dazugehört – idealerweise sind das automatisch alle, die sich im Unternehmen mit diesem Thema beschäftigen. Zusätzlich sollte definiert sein, ob die Community offen für alle ist – oder ob eine begrenzte Mitgliedschaft sinnvoll ist, etwa bei sensiblen Inhalten oder Datenschutzanforderungen.
- Wöchentliche Lernzeit fest verankern: Eine fest vereinbarte Lernzeit von mindestens einer Stunde pro Woche sollte mit den Führungskräften abgestimmt sein – und ausdrücklich zur Teilnahme an Community-Sessions oder anderen Lernformaten genutzt werden können. Besonders Geschäftsführung, Betriebsrat und Führungskräfte sollten mit gutem Beispiel vorangehen und regelmäßig an Community-Veranstaltungen teilnehmen. Denn: Community-Lernen kennt keine Hierarchie. Es lebt davon, dass Lernen als Teil des Alltags verstanden wird – auf allen Ebenen.
- Wissensträger identifizieren und einbinden: Ohne aktive Wissensträger – intern wie extern – bleibt eine Community inhaltlich leer. Deshalb sollten interne Experten frühzeitig identifiziert und gemeinsam mit ihren Führungskräften verbindlich abgestimmt werden – insbesondere, wie viele Stunden sie monatlich oder in einem definierten Zeitraum konkret zur Verfügung stehen können. Steht das Stundenkontingent fest, lässt sich gezielt planen, wie dieses sinnvoll genutzt werden kann – z. B. für Blogartikel, kurze Wissensimpulse oder eine Eventreihe über das Jahr hinweg.
- Ein „Wissensteam” aufbauen und fördern: Besteht eine Gruppe von aktiven Wissensträgern, lohnt es sich, sie gezielt zu begleiten – eine zentrale Aufgabe für das Community Management. Dieses „Wissensteam“ erhält besondere Unterstützung und Up-Skilling-Angebote, um das eigene Know-how professionell in unterschiedlichen Formaten weiterzugeben (z. B. Videoaufzeichnungen, Blogartikel, interaktive Learn&Share-Sessions). Gleichzeitig zeigt das Unternehmen so: Wer sein Wissen teilt, bekommt Unterstützung – und wird im Unternehmen auch als Experte wahrgenommen.
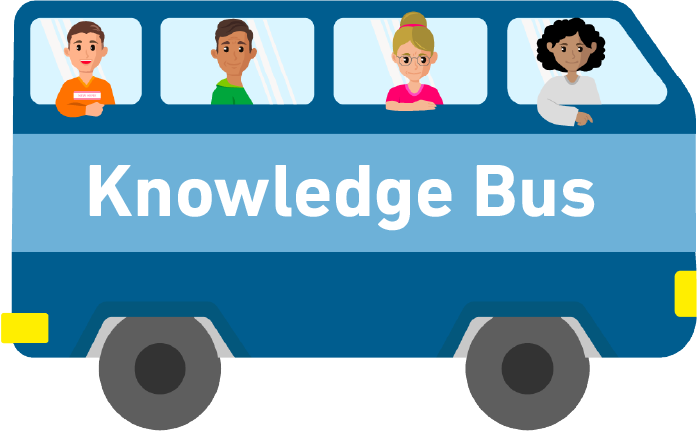
- Förderung der aktiven Mitarbeit: Eine zentrale Aufgabe der Bildungs-Stakeholder – insbesondere von Geschäftsführung, Führungskräften und Betriebsrat – ist es, im Unternehmen deutlich zu machen: Aktive Mitarbeit in der Community ist kein „Extra“, sondern eine wertvolle Entwicklungschance. Wer Wissen teilt oder bei der Wissensbereitstellung unterstützt (z. B. durch Content Curation), stärkt dabei ganz nebenbei wichtige Kompetenzen – etwa in Führung, Präsentation oder Moderation – und erhöht gleichzeitig die eigene Sichtbarkeit im Unternehmen.
- Angebots- und Kommunikationsplan: Alle Aktivitäten – ob Veranstaltungen, Newsletter oder andere Formate – sollten idealerweise sechs Monate im Voraus geplant werden. Die Erstellung und Umsetzung dieses Plans gehört zu den wichtigsten Aufgaben des Community Managers. Denn ohne klaren Fahrplan fehlt der rote Faden – und eine Community lässt sich auf Dauer kaum erfolgreich betreiben.
- Wissen teilen muss vorgelebt werden: Es reicht nicht aus, einmal zu betonen, wie wichtig das Teilen von Wissen ist – es muss konsequent sichtbar gelebt werden. Nur wenn Geschäftsführung, Personalentwicklung, Betriebsrat und Führungskräfte immer wieder deutlich machen, dass Community-Arbeit einen festen Platz im Arbeitsalltag hat – und dies auch selbst vorleben – entsteht echtes Commitment. Am stärksten wirkt es, wenn Führungskräfte und Entscheider ihr eigenes Wissen aktiv in Sessions einbringen. Der Aufwand dafür ist überschaubar – der Effekt auf Kultur und Wertschöpfung hingegen enorm.
- Festlegung von Erfolgsindikatoren: Auch wenn eine Community mindestens 18 Monate bestehen sollte, braucht es bereits vorher regelmäßige Rückmeldungen zur Nutzung: Teilnehmerzahlen, Feedbacks und konkrete Mehrwerte durch den Wissenstransfer sollten monatlich oder quartalsweise mit den Bildungs-Stakeholdern geteilt werden. Ebenso wichtig ist es, von Beginn an gemeinsame Erfolgsindikatoren festzulegen – inklusive messbarer Ziele und Zeitrahmen. Nur so lässt sich nachvollziehen, welchen Beitrag die Community tatsächlich leistet.
- One-Stop-Shop statt Zeltlager: Einen funktionierenden Kommunikationskanal aufzubauen, ist anspruchsvoll – noch anspruchsvoller ist es, das Vertrauen der Mitarbeitenden so zu stärken, dass sie gezielt und zuerst in der Wissenscommunity nach Informationen suchen, wenn es um „ihr Thema“ geht. Deshalb sollte das gesamte Change- und Kommunikationsmanagement aller relevanten Projekte in diesem Themenfeld konsequent über die Community laufen – nicht über parallele Kanäle. Vor allem Führungskräfte sind gefragt, projektbezogene Einzelkanäle und separate „Wissens-Zeltlager“ zu vermeiden – und die Community als zentrale Anlaufstelle aktiv zu stärken.
- Kooperation mit anderen Wissenscommunities: Wissenscommunities sind von Beginn an Informationsdrehscheiben, keine abgeschlossenen Systeme. Da nicht alle Themen in einer einzelnen Community abgedeckt werden können – und auch nicht sollten –, ist es wichtig, frühzeitig den Austausch mit anderen Wissenscommunities im Unternehmen zu suchen. Sie profitieren voneinander, indem sie auf gute Inhalte und Sessions hinweisen und sich gegenseitig sichtbar machen. Auch der regelmäßige Austausch der Community Manager ist essentiell – denn nur so lassen sich Inhalte koordinieren und Doppelungen oder parallele Veranstaltungen vermeiden.
Die Hauptbestandteile einer Wissenscommunity
Die folgenden sechs Bestandteile bilden das methodische Fundament jeder erfolgreichen Community:

1. Thematischer Fokus
Jede Community braucht einen klaren thematischen Fokus.
Doch welches Thema steht im Mittelpunkt – und wer legt die konkreten Inhalte fest?
Idealerweise geschieht dies in regelmäßigen Abständen – abgestimmt mit den Wissensträgern, Führungskräften und dem L&D-Team, parallel zur Kommunikations- und Eventplanung. Die thematischen Schwerpunkte sollten sich dabei an zwei Dingen orientieren: an der aktuellen geschäftlichen Entwicklung und an den konkreten Bedarfen der Community-Mitglieder.
Ein sinnvoller Rhythmus ist einmal pro Quartal. In einem dynamischen Umfeld ist eine einmal jährliche Festlegung meist zu unflexibel, um wirklich relevant zu bleiben.
2. Aufbau der Wissenslandschaft
In welchem System soll die Community verankert werden – und welche Tools und Plattformen sind bereits im Einsatz?
Welche Formate funktionieren gut, und welche Erfahrungen gibt es bereits bei der Erstellung und Verbreitung von Wissensinhalten?
Ein enger Austausch mit der L&D-Abteilung ist hier entscheidend, um bestehende Strukturen gezielt zu nutzen und von vorhandenen Best Practices und Lessons Learned zu profitieren. So wird kein neues „Wissens-Dorf“ geschaffen, sondern eine Landschaft, die anschlussfähig ist und echte Mehrwerte liefert.

Artikel Empfehlung:
In unserem Artikel „Wissenstransfer richtig angehen – damit wertvolle Expertise im Unternehmen bleibt” erklären wir Ihnen genau, warum der Schritt der Wissensidentifizierung so wichtig ist – und wie Sie dabei am besten vorgehen.
3. Etablierung eines aktiven Wissensteams
Die wichtigsten internen und ggf. externen Wissensträger sollten frühzeitig identifiziert werden. Für jede Person gilt es zu klären, unter welchen Voraussetzungen eine aktive Mitarbeit in der Community möglich ist – zum Beispiel, wie viel Zeit konkret zur Verfügung steht.
Da solche Experten meist stark eingebunden sind, lautet der Praxistipp: Nehmen, was möglich ist. Denn auch zwei Stunden im Monat reichen aus, um wertvolle Wissensformate zu entwickeln – etwa kurze Impulse, Mini-Serien oder Q&A-Sessions.
Alle aktiven Wissensträger werden zu einem festen Wissensteam zusammengeführt. Dieses erhält vom Community Manager gezielte Informationen, Austauschformate und individuelle Unterstützung, um den Wissenstransfer so einfach und wirksam wie möglich zu gestalten.
4. Community Management
Jede Wissenscommunity braucht klare Rollen und Zuständigkeiten – von den Wissensträgern über Wissenslotsen bis hin zum Community Manager.
Besonders wichtig ist dabei, die Aufgaben rund um das strategische und operative Community Management frühzeitig zu definieren. Denn genau dieser Bereich wird in der Praxis häufig unterschätzt.
Ein funktionierendes Community Management ist der Schlüssel dafür, dass der Austausch gelingt, passende Formate entstehen – und die Community langfristig aktiv und lebendig bleibt.
Artikel Empfehlung:
In Teil 4 dieser Serie „Rollen einer Wissenscommunity – Welche wichtig sind und wie sie besetzt werden” werfen wir einen genaueren Blick auf die Rollen einer Wissenscommunity – und wie Sie sie gezielt besetzen.
5. Kommunikationskonzept
Ein durchdachtes Kommunikations- und Visualisierungskonzept macht die Community nicht nur sichtbar, sondern auch zugänglich und relevant für alle. Wichtig ist, regelmäßig und verständlich zu vermitteln: Warum gibt es die Community? Und was bringt sie mir persönlich?
In der Praxis bewährt haben sich dafür Formate wie monatliche Newsletter, visuelle Lernpläne oder persönliche Erfahrungsberichte.
6. Kontinuierliche Erfolgsmessung
Um den Erfolg einer Community sichtbar zu machen, braucht es klare Ziele und messbare Kennzahlen. Teilnahmequoten, geteilte Inhalte, interne Empfehlungen oder eingesparte Zeit sind typische Indikatoren.
Wichtig dabei: Der Mehrwert muss sichtbar und verständlich kommuniziert werden – sowohl an die Community-Mitglieder als auch an das Management. Nur so entsteht langfristige Akzeptanz und Unterstützung.
Fazit
Wissenstransfer ist kein Zufallsprodukt. Und eine Wissenscommunity entsteht nicht über Nacht. Sie wächst strategisch – und zwar nur dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Wer also denkt, ein gemeinsamer Teams-Ordner oder eine einmalige Wissensweitergabe reichen aus, unterschätzt das Potenzial einer gelebten Community. Denn nur dort, wo Wissen geteilt, diskutiert und gemeinsam weiterentwickelt wird, entsteht nachhaltiger Mehrwert – für den Einzelnen und fürs ganze Unternehmen.
Damit das gelingt, braucht es klare Strukturen, echte Verbindlichkeit – und ein Mindset, dass das Lernen nicht als Zusatzaufgabe begreift, sondern als Teil des Arbeitsalltags.
Wichtig ist: Bleiben Sie praxisnah. Setzen Sie auf vorhandene Tools, Formate und Prozesse – und verankern Sie die Community fest in Ihrer Organisation.
Im nächsten Artikel unserer Serie „Wissensmanagement im Alltag – So wirkt Ihre Community in der Praxis” geht es an die Umsetzung: Wir zeigen, wie Ihre Wissenscommunity im Alltag wirklich wirksam wird – mit passenden Formaten, integrierten Tools, klaren Rollen und einer Umgebung, in der Lernen und Wissensaustausch ganz selbstverständlich dazugehören.
Sie möchten tiefer einsteigen?
Zu jedem Artikel dieser Serie gibt es eine 30-minütige Deep Dive Session – live auf LinkedIn.
Mi., 06.08.2025 um 13 Uhr | Jetzt kostenlos dabei sein!
Termin verpasst?
Kein Problem – gerne unterstützen wir Sie persönlich beim Aufbau und der Planung Ihrer Wissenscommunity.
Jetzt Ihr kostenloses Erstgespräch sichern!
Offene Fragen?
Eine Wissenscommunity ist eine strukturierte Lerngemeinschaft innerhalb eines Unternehmens, in der Fachwissen gezielt geteilt, weiterentwickelt und dokumentiert wird.
Im Gegensatz zu einem klassischen Team, das meist auf ein konkretes Projekt oder Tagesgeschäft ausgerichtet ist, verfolgt eine Wissenscommunity das Ziel, Erfahrungswissen langfristig zu sichern und den Wissenstransfer über Rollen und Hierarchien hinweg zu fördern.
Um eine Wissenscommunity erfolgreich aufzubauen, braucht es vor allem drei Dinge: klare Strukturen, echtes Commitment der Führung – und die Integration in bestehende Systeme. Der Aufbau gelingt nicht „nebenbei“, sondern braucht Zeit, Raum und eine strategische Einbettung in die Lern- und Kommunikationsprozesse des Unternehmens.
Der zeitliche Aufwand für die Teilnahme an einer Wissenscommunity ist bewusst niedrigschwellig gehalten – denn Ziel ist es, Wissen teilen in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Viele Unternehmen etablieren eine feste wöchentliche Lernzeit (z. B. 60 Minuten), in der Mitarbeitende sich austauschen, Inhalte aus dem Wissensnetzwerk nutzen oder an Formaten wie „Learn&Share“ teilnehmen können.
Die Fokusthemen einer Lerngemeinschaft sollten sich eng an den realen Bedarfen im Fachbereich orientieren.
Fragen Sie sich: Wo entsteht wertvolles Erfahrungswissen? Welche Herausforderungen beschäftigen die Teams aktuell? Und in welchen Bereichen kann gemeinsames Lernen echten Mehrwert schaffen?
Hilfreich ist es, Führungskräfte und Mitarbeitende früh einzubinden – z. B. durch kurze Umfragen oder Feedback-Runden. So entsteht ein Wissensnetzwerk, das nicht an den Bedürfnissen vorbeiplant, sondern konkrete Themen aufgreift, die im Alltag relevant sind.
Dieser Beitrag ist Teil einer fünfteiligen Serie: Hier geht es zu Teil 3: Wissensmanagement im Alltag – So wirkt Ihre Community in der Praxis
Sie haben noch eine offene Frage? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail und wir helfen Ihnen gerne weiter.
Autorin: Elisabeth Schulze-Jägle Profil bei LinkedIn